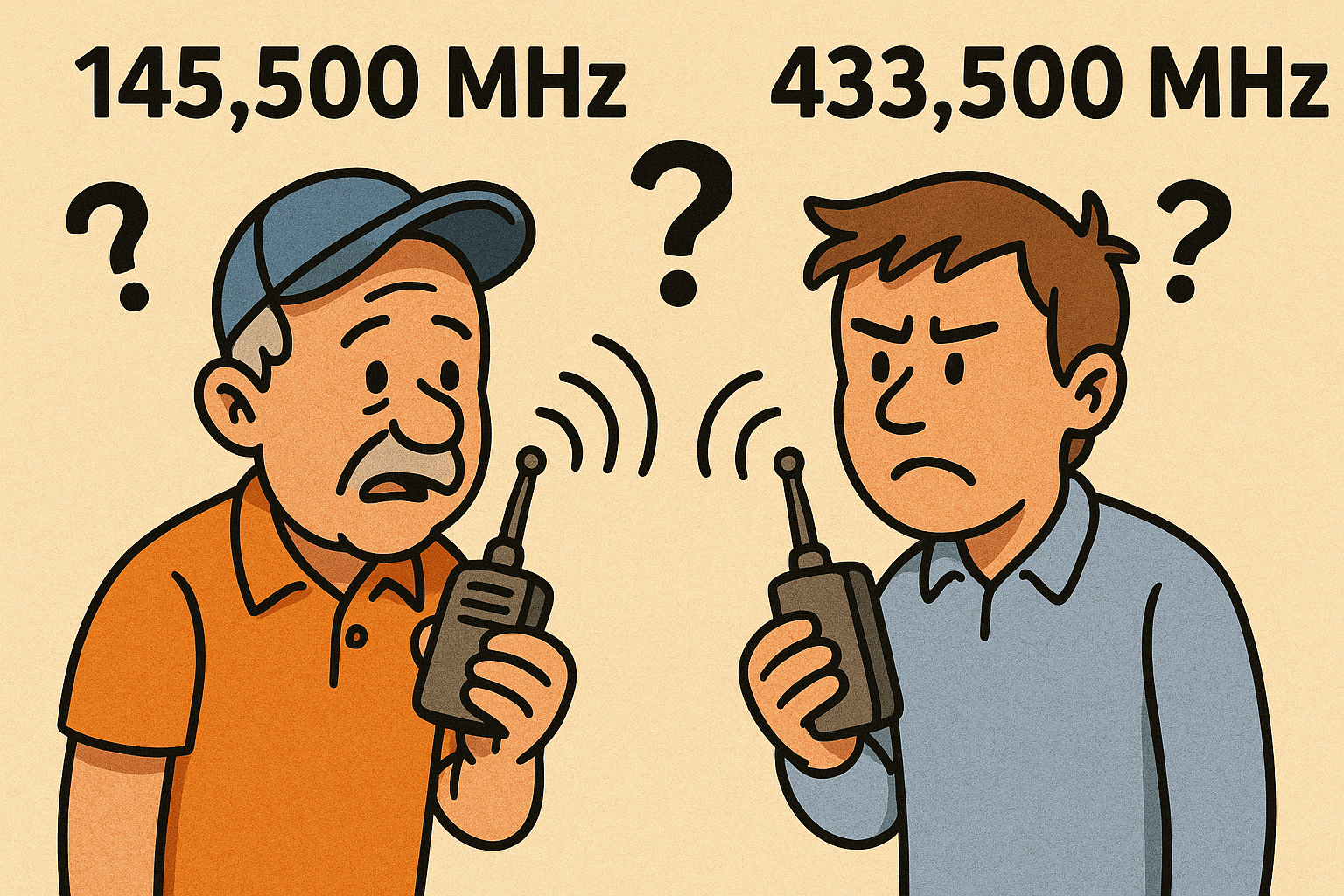
📡 Wenn alles stillsteht: Wie Notfunkfrequenzen Leben retten können
16. Juli 2025Wenn Stromausfälle Mobilfunkmasten lahmlegen und Internetverbindungen zusammenbrechen, bleibt oft nur ein Kommunikationsweg: Funk.
Doch wer im Krisenfall zum Mikrofon greift, steht schnell vor der Frage:
Welche Notfunkfrequenzen sind in Deutschland für Notfunk und Erstkontakt tatsächlich relevant – und welche Mythen kursieren nur in Foren?
Im Jahresbericht 2023 verzeichnete die Bundesnetzagentur über 30 größere Netzausfälle durch Naturereignisse, Starkregen und technische Defekte.¹
In solchen Situationen bewährten sich Funkamateure als flexible Kommunikationsbrücken – vorausgesetzt, sie wissen, auf welchen Frequenzen sie gehört werden.
Dieser Leitfaden fasst die deutschen und internationalen Not- und Anruffrequenzen zusammen, erläutert ihre rechtliche Grundlage und zeigt, wie sie in der Praxis sicher und regelkonform genutzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Grundlagen und Normen
- 2. Offizielle Anlauf- und Notfunkfrequenzen
- 3. Praktische Anwendung im Einsatz
- 4. Checkliste: Funkbereit im Ernstfall
- 5. Sicherheits- und Rechtsvorgaben
- 6. Fehlerdiagnose / Troubleshooting
- 7. Praxisbeispiel: Hochwasserlage an der Elbe
- 8. FAQ zu den Notfunkfrequenzen
- 9. Fazit & Handlungsempfehlung
1. Grundlagen und Normen
Die Nutzung Notfunkfrequenzen ist im Amateurfunkdienst nicht willkürlich, sondern international koordiniert.
Rechtlich basiert sie auf folgenden Säulen:
- Amateurfunkgesetz (AFuG) und Amateurfunkverordnung (AFuV)
- Bandpläne der IARU Region 1 (Europa, Afrika, Naher Osten)
- Empfehlungen des DARC e. V. (Deutscher Amateur-Radio-Club) für nationale Nutzung
Die International Amateur Radio Union (IARU) definiert sogenannte
„Centres of Activity“ (CoA) – das sind Sammelfrequenzen, auf denen Funkamateure in Not- oder Krisenlagen vorrangig aktiv werden.
Sie dienen nicht als exklusive Notrufkanäle, sondern als Anlaufpunkte für Erstkontakte, Lagebilder und Informationsaustausch.
2. Offizielle Anlauf- und Notfunkfrequenzen
2.1 Kurzwelle (HF) – internationale CoA-Frequenzen
(Quelle: IARU Region 1 – Emergency Communications Frequencies, 2025)
| Band | Frequenz (kHz) | Betriebsart | Bedeutung / Hinweise |
|---|---|---|---|
| 80 m | 3 760 | LSB | Regionale Notfunkverbindungen in Europa |
| 40 m | 7 110 | LSB | Hohe Reichweite, stabile Tag-Nacht-Bänder |
| 20 m | 14 300 | USB | Weltweit aktive Notfunkfrequenz („Maritime Mobile Net“) |
| 17 m | 18 160 | USB | Alternative für Mittelstreckenverkehr |
| 15 m | 21 360 | USB | Gute Reichweiten bei Tageslicht |
Diese Frequenzen sind international abgestimmt und werden auch von Notfunkverbänden, Seefunkstationen und internationalen Netzen regelmäßig überwacht.
Im europäischen Kontext ist 14 300 kHz USB die wichtigste globale Notfunk-CoA.
2.2 VHF – 2 m-Band (144–146 MHz)
| Notfunkfrequenzen (MHz) | Betriebsart | Nutzung / Bedeutung | Quelle |
|---|---|---|---|
| 145,500 | FM | Anruffrequenz – erster Kontaktpunkt, danach QSY auf freie QRG | IARU R1 VHF Bandplan 2020 |
| 144,300 | USB | SSB-Aktivitätszentrum / Anruffrequenz (Europa) | IARU R1 VHF Bandplan 2020 |
| 145,375 | DV | Digital-Voice-Calling (D-Star, DMR, C4FM) | IARU R1 VHF Bandplan 2020 |
2.3 UHF – 70 cm-Band (430–440 MHz)
| Notfunkfrequenzen (MHz) | Betriebsart | Nutzung / Bedeutung | Quelle |
|---|---|---|---|
| 433,500 | FM | Anruffrequenz – lokale Simplex-Kontakte, erste Rufmöglichkeit | IARU R1 UHF Bandplan 2021 |
| 433,450 | DV | Digital-Voice-Calling, netzübergreifend | IARU R1 UHF Bandplan 2021 |
Diese Frequenzen werden in Deutschland aktiv genutzt, insbesondere von Relais- und Notfunkgruppen.
Sie eignen sich als lokale Sammelkanäle bei Netzausfall oder Koordinierungseinsätzen.
2.4 Ergänzende Dienste – See-, Luft- und Bürgerfunk
- Seefunk (GMDSS):
- VHF Kanal 16 (156,800 MHz) – Not- und Anrufkanal (Sprache)
- VHF Kanal 70 (156,525 MHz) – Digital Select Calling (DSC, keine Sprache)
- MF/HF DSC-Paare → 2 187,5 kHz (DSC) / 2 182 kHz (Sprache) usw.
(Quelle: ITU-R M.541-9)
- Luftfunk:
- 121,500 MHz (VHF Guard) – internationale Notfrequenz (zivil)
- 243,000 MHz (UHF Guard) – militärisch
- 406 MHz (Cospas-Sarsat) – Notfunkbaken (EPIRB, ELT, PLB)
(Quellen: ICAO / NOAA SARSAT)
- CB-/PMR-Funk:
- CB Kanal 9 (27,065 MHz) – inoffizieller Rufkanal, keine behördliche Notruf-Funktion
- PMR Kanal 8 (446,09375 MHz) mit CTCSS 16 – freiwillige Community-Empfehlung
(Quelle: BNetzA-Allgemeinzuteilung 2021)
Diese Frequenzen gehören nicht zum Amateurfunkdienst, können aber in der Bevölkerung als niedrigschwellige Ergänzung dienen.
3. Praktische Anwendung im Einsatz
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Funkamateure
- Empfang vorbereiten:
Funkgerät auf 145,500 MHz FM oder 433,500 MHz FM stellen. Rauschsperre leicht öffnen, damit schwache Signale hörbar bleiben. - Erstkontakt herstellen:„CQ Notfunk, CQ Notfunk – hier DO1CHP in Rheine. Wer hört mich auf dieser Frequenz?“
- Nach Antwort:
- Standort und Situation klar benennen.
- Gemeinsame Ausweichfrequenz (QSY) vereinbaren.
- Meldungen kurz, sachlich, mit Uhrzeit und Rufzeichen.
- Logbuch führen:
- Zeit, Frequenz, Gegenstation, Inhalt und Maßnahmen.
- Bei Netzübernahme: Weiterleitung an Einsatzleitung oder Leitstelle.
- Nachbereitung:
- Funkprotokoll sichern, Technik überprüfen, Energieversorgung wieder auffüllen.
Praxis-Tipp für die Verwendung der Notfunkfrequenzen
In Krisen ist Funkdisziplin entscheidend: keine Dauerträger, keine unnötigen Gespräche.
Ein klarer, ruhiger Funkverkehr vermittelt Kompetenz – und Vertrauen bei Behörden.
4. Checkliste: Funkbereit im Ernstfall
| Prüfpunkte | Sollwert / Ziel | Kontrolle |
|---|---|---|
| Antenne | SWR < 2,0 : 1 | SWR-Meter oder Analyzer |
| Versorgung | ≥ 12,0 V DC | Spannungsmessung |
| Ausgangsleistung | 5–50 W (Mobilstation) | Wattmeter |
| Audioqualität | klar, verzerrungsfrei | Gegentest / Kopfhörer |
| Rufzeichen / Log | vollständig | Logbuch |
| Unterlagen | Karte, Sprechschema, Notfallplan | laminiert, griffbereit |
5. Sicherheits- und Rechtsvorgaben
- AFuG § 2 / AFuV § 13:
Funkbetrieb nur mit gültiger Zulassung (Klasse A/E/CE). - § 48 AFuV:
Inhalte müssen sich auf Funkbetrieb beziehen; keine personenbezogenen Daten. - BOS-Funk:
Nutzung durch Funkamateure verboten. - Fremde Dienste:
Keine Aussendungen auf Luft-, See- oder Behördenfrequenzen. - Störungsvermeidung:
- Kein Dauerträger auf Calling-Frequenzen
- Relaisnutzung nur nach Freigabe
- Netzunabhängige Stromversorgung bevorzugt
6. Fehlerdiagnose / Troubleshooting
| Symptom | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Keine Antwort auf Anruf | Frequenz überlastet, niemand QRV | Band oder Standort wechseln |
| Rauschen / kein Signal | Antenne defekt oder SWR zu hoch | Koax prüfen, SWR messen |
| Gerät schaltet ab | Unterspannung | Akku prüfen, Ersatzakku bereitstellen |
| Verzerrte Sprache | Mikrofonpegel zu hoch | Gain reduzieren |
| Digitalverbindung bricht ab | Codec-Inkompatibilität | Einheitliches DV-System abstimmen |
| Rauschsperre öffnet nicht | Schwaches Signal / Squelch zu hoch | Rauschsperre justieren |
7. Praxisbeispiel: Hochwasserlage an der Elbe
Im Sommer 2023 unterstützten Funkamateure aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Brandenburg bei der Koordination von Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Elbe.²
Als mehrere Mobilfunkzellen ausfielen, stellte ein lokaler DARC-Ortsverband über 2 m eine Funkverbindung zwischen der Einsatzleitung und mobilen Pegeltrupps her.
- Erstkontakt: 145,500 MHz FM (Calling)
- Arbeitsfrequenz: 145,525 MHz FM (Simplex)
- Betrieb: 25 W Mobilstation, Stromversorgung über LiFePO₄-Akkus
- Ergebnis: stabile Sprachverbindung über 20 km, dokumentierter Lagemeldungstransfer
Das Beispiel zeigt, wie Anruffrequenzen als Startpunkt dienen, um anschließend strukturierte Kommunikationsnetze aufzubauen – auch ohne Relais oder Internet.
8. FAQ zu den Notfunkfrequenzen
1. Gibt es im Amateurfunk einen offiziellen Notrufkanal?
Nein. Es existieren Anruf- und Aktivitätsfrequenzen, keine exklusiven Notrufkanäle.
2. Welche Notfunkfrequenzen zuerst abhören?
145,500 MHz FM (2 m) und 433,500 MHz FM (70 cm) – das sind die bewährten Einstiegspunkte.
3. Ist 144,260 MHz eine Notfunkfrequenz?
Nein. Sie ist nicht im IARU- oder DARC-Bandplan festgelegt.
Diese Information konnte nicht abschließend verifiziert werden.
4. Darf ich ohne Lizenz mithören?
Ja. Empfangen ist erlaubt, Senden nicht.
5. Wie oft sollte die Technik getestet werden?
Empfohlen: monatlicher Funktionstest und jährliche Wartung der Energieversorgung.
6. Wie hoch darf die Sendeleistung sein?
Nach AFuV § 17 richtet sie sich nach Lizenzklasse – im Notfunk genügt meist 5–50 W.
7. Was tun, wenn niemand antwortet?
Band wechseln (z. B. 14 300 kHz USB) oder Standort erhöhen.
8. Wie erkenne ich Relais mit Notstrom?
Viele DARC-Ortsverbände kennzeichnen diese auf ihren Webseiten oder Listen.
9. Sind CB- oder PMR-Kanäle sinnvoll für Laien?
Ja, als lokale Ergänzung – aber ohne rechtlichen Notrufstatus.
10. Welche Antennen eignen sich für portablen Notfunk?
λ/4-Mobilantennen, End-Fed-Drähte oder vertikale Multiband-Antennen mit SWR < 2:1.
9. Fazit & Handlungsempfehlung
Notfunk beginnt nicht erst im Krisenfall, sondern mit Vorbereitung.
Funkamateure, die ihre Anlauf- und Notfunkfrequenzen routiniert beherrschen, werden im Ernstfall schnell handlungsfähig.
Die wichtigsten Punkte:
- 145,500 MHz FM und 433,500 MHz FM als primäre Calling-Frequenzen nutzen.
- 14 300 kHz USB auf Kurzwelle im Blick behalten.
- Funkdisziplin, Protokollführung und Energieversorgung trainieren.
Schlussfazit:
Dieser Leitfaden bietet eine fundierte Orientierung für alle, die im Notfunk aktiv sind oder werden wollen.
Wer regelmäßig übt und seine Station pflegt, schafft die Grundlage, im Ernstfall verlässlich zu kommunizieren – auch wenn alles andere stillsteht.